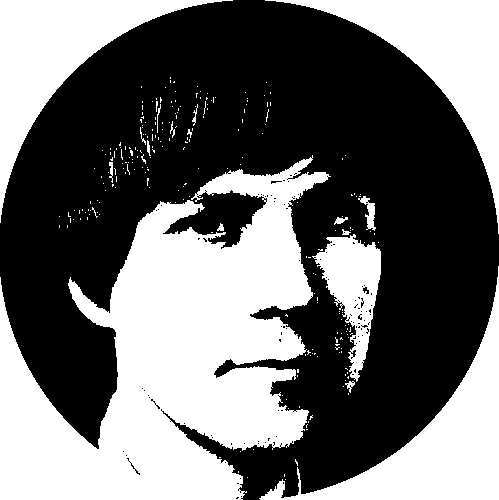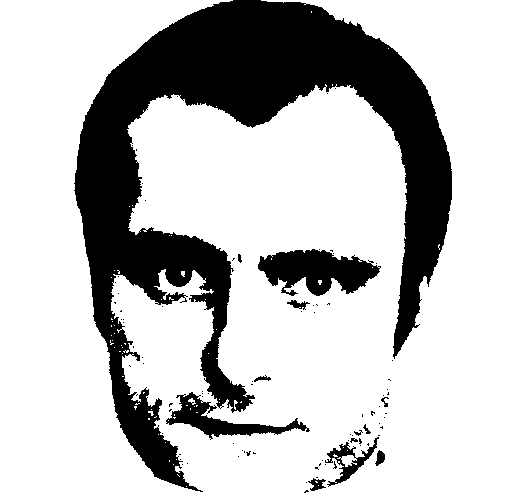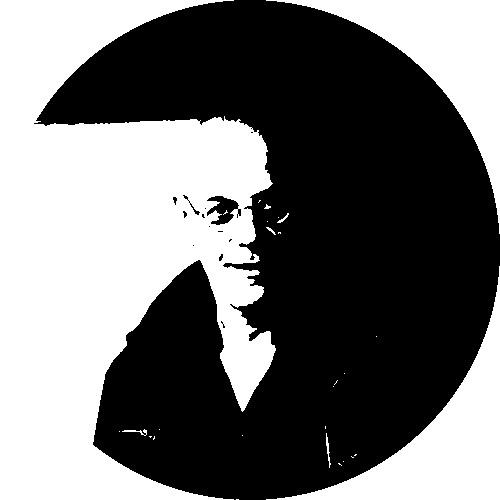Was war das Netz?
Was war das Netz?
Die erste Frage, die ich gern besprechen möchte, lautet: „Was war das Netz?“ Von hier aus können wir auch darüber nachdenken, ob wir uns in einem Moment befinden, in dem es möglich ist, Netzwerke zu historisieren – und wenn ja, warum wir das tun sollten.
Ich finde die Vergangenheitsform – „Was war das Netz?“ – hier ziemlich provokativ. Unter den Bedingungen des Überwachungskapitalismus und der Plattformen hat sich der Diskurs über das Digitale tatsächlich verschoben. Wir befinden uns in einer völlig anderen Situation im Vergleich zu dem, was wir als Netzwerke der 1990er Jahre bezeichnen, als damit eine große Hoffnung auf eine funktionierende Dezentralisierung von Information und Handlungsfähigkeit verbunden war. Doch wenn ich mir andere Felder ansehe, habe ich den Eindruck, dass keine Netzwerke aufgebaut wurden – wie könnten sie sich also aufgelöst haben? Ich meine Bereiche, in denen Menschen sich noch nicht zum gemeinsamen Handeln organisiert haben – jenseits von kleinen Gruppen und Nachbarschaften. Nehmen wir beispielhaft die vielen städtischen Basisinitiativen in Berlin, die sich erst seit Kurzem um die Bildung größerer Netzwerke bemühen, um gegen Gentrifizierung zu kämpfen. Ich glaube, es gibt hier eine interessante Lücke zwischen dem, wie in der digitalen Kultur und Theorie die Wahrnehmung besteht, wir seien schon über das Netz hinaus, es sei schon verloren oder korrumpiert worden, während wir in anderen Bereichen in der Praxis gerade erst die nächsten Stufen der vernetzten Zusammenarbeit und Kommunikation erreichen.
Als ich die Frage zum ersten Mal las – „Was war das Netz?“ – dachte ich eher an die architektonische Topologie, die nicht umgesetzt wurde, den Traum von der dezentralisierten oder ausgeglichen verteilten Architektur des Netzwerks, der sich nicht erfüllt hat. Der Traum von einem Netzwerk, das in Wirklichkeit von den mächtigeren Mainstream-Infrastrukturen übernommen wurde. Und nun gibt es diese Frage, die mich immer zu den Erwartungen der 1990er Jahre und den ersten Plattformen mitnimmt – Internet Relay Chat, Usenet. Es gab all diese Erwartungen – was ist also geschehen, was hat sich verändert? Der Ansatz von Manuel Castells drehte sich beispielsweise darum, wie Kommunikationsnetze die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur verändern würden. Und diese Veränderung hat stattgefunden, aber nicht so, wie sie sich damals vorgestellt wurde. Jetzt sehen wir auch die dunklen Seiten des Netzes.
Wenn ich auf persönlicher Ebene an die späten 1990er und frühen 2000er Jahre denke, erinnere ich mich noch, wie wichtig es war, dass wir uns nun verbinden und vernetzen konnten. Ich war damals in Athen und arbeitete für ein Festival über Kunst und – wie wir sie damals nannten – neue Technologien, Medi@terra. Anfangs war es ein griechisches Festival, später umfasste es den Balkan und wurde schließlich international. Das Festival wuchs dank der Netzwerke, die wir mit anderen Festivals und Zentren in dem Feld schufen, dank der Recherchen, die wir online anstellen konnten und dank des Interesses, das Publikum und Förderinstitutionen am Aufkommen digitaler Netzwerke zeigten. Für mich war das Netzwerk diese Potenzialität – das konnte das Netz sein. Doch heute scheint mir der Glaube daran nicht mehr möglich.
Lasst uns über die Frage nach dem Netz sprechen. Mein Essay trägt den Titel „RequiemfürdasNetz“, aber der Arbeitstitellautete „Netzrenaissance“. Wie ihr seht,bin ich hier unentschlossen: Wird das Netz verschwinden oder wieder auftauchen? Eine bestimmte Generation (vielleicht meine und die darauffolgende) ist ein bisschen widerwillig, unsere politische Mediengeschichte auf ähnliche Weise zu schreiben, wie es die 68er-Generation getan hat. Es gab mal eine kollektive Verpflichtung, die eigene Geschichte zu dokumentieren, um sie an die nächste Generation weiterzugeben, aber das sehe ich hier nicht geschehen. Das scheint nicht mehr automatisch nahezuliegen. Vielleicht liegt das an Zweifeln bezüglich des Konzepts Geschichte. Anstatt die Geschichte-im-Entstehen unserer Netzwerke, Bewegungen, Gemeinschaften und Veranstaltungen zu erläutern, Erinnerungen und Anekdoten auszugraben, neigen wir dazu, über das Konzept Geschichte selbst nachzudenken.
In den Medienwissenschaften lieben wir diese Art von Fragen in der Vergangenheitsform. Doch die aktuelle Debatte über die Digitalisierung erscheint völlig ahistorisch, als habe das ‚Digitale‘ gerade erst die Bühne betreten. Diese historische Vergessenheit gilt besonders, wenn es um Netzwerke und ihre Implementierung in digitalen Medienindustrien geht. Doch über die Vergangenheit nachzudenken, muss nicht unbedingt einen veralteten Historizismus bedingen – im Sinne eines Verständnisses, dass eine bestimmte Zeit in der Geschichte linear zur Gegenwart führte. Mich interessiert vielmehr eine nicht-lineare und eklektische Mediengenealogie. Walter Benjamin spricht von ‚Historizität‘ im Gegensatz zum ‚Historizismus‘ oder von Jetztzeit – ein Begriff, der genau zu der ‚ewigen Gegenwart‘ der diesjährigen Ausstellung „Das Ewige Netzwerk“ passt. Benjamin meinte damit, dass zwei weit voneinander entfernte historische Ereignisse mehr gemeinsam haben können als zwei Ereignisse, die sich zeitlich nahe liegen. Diese Historizität ist stets gegenwärtig und richtet die Vergangenheit am Hier und Jetzt aus – und an der Zukunft. Was Daphne über den anbahnenden Traum vom Netz und über dessen heutige Potenzialität sagte, ist eine gute Schilderung solch einer Jetztzeit.
Seht ihr Potenzial für eine merkwürdige Rückkehr des Netzes in der Digitalisierung oder ist das nur die nostalgische Projektion einer vorherigen Netz-Generation? Oder könnte sogar mit der Spur einer solchen Nostalgie noch ein Wert in dieser Vorstellung liegen – mit Blick darauf, wie die Digitalisierung zum neuen allumfassenden Begriff geworden ist, der noch viel breiter zu funktionieren scheint, als das Netz es tat oder tut?
Wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir natürlich über eine jahrzehnte- oder sogar jahrhundertealte Entwicklung. Wir müssen aber nicht die ganze Geschichte durchgehen, um darüber nachzudenken. Durch vergangene Ereignisse die Gegenwart denkbar zu machen, kann sehr episodisch sein. Das ist auch ein interessanter Aspekt an der Netz-Metapher – sie hat diese Unzeitlichkeit an sich. Sie taucht in den 1990er Jahren auf, um ziemlich unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungen begreifbar zu machen, wie die neue weltweite Kommunikationsinfrastruktur, verknüpft mit der Hoffnung auf demokratischen Ausdruck sowie den letzten Schub eines gänzlich globalisierten Kapitalismus. Damit wird das Netz zu einem allumfassenden, alles erklärenden Konzept: von Nahrungsketten über Lieferindustrien bis zum Nervensystem. Patrick Jagoda hat dies das „vollendete Netzwerk“ genannt: Das Netz ist alles und nichts1. Und vielleicht ist das das Beste, was ihm hätte passieren können – zu diesem seltsamen unzeitgemäßen Konzept zu werden. Wie die Jetztzeit, kann es sich immer aktualisieren, es kann sich mit verschiedenen Arten der Vergangenheit und Zukunft verbinden.
Und das Faszinierende im heutigen Kontext ist, dass es bei diesem ‚Zu-einem-Netzwerk- Werden‘ oder ‚Netz-Werden‘ auch darum geht, sichtbar zu werden. Die meisten aktuellen Debatten über Digitalisierung sind tendenziell von Debatten über Plattformen dominiert. Aus meiner Sicht ist aber noch immer das Netz die treibende Kraft – der Motor – hinter den meisten Phänomenen der digitalen Kultur. Auch wenn der digitale Kapitalismus sich im letzten Jahrzehnt zu Plattformen verdichtet hat, beruht die innere Funktionsweise, die Art, wie sie durch Datenextraktion und -interpretation Wert schöpfen, noch immer auf einer Netzwerklogik.
- 1. Siehe etwa: Patrick Jagoda, Network Aesthetics, Chicago: The University of Chicago Press, 2016.
Es könnte interessant sein, dieses Problem aus der Perspektive zeitgenössischer Kunst zu betrachten. Im Feld der zeitgenössischen Kunst der 1990er Jahre spielte das Netz eine wichtige Rolle. Es war vielleicht nicht so technologisch oder auf das Internet an sich fokussiert, aber das Netz war doch sehr präsent. Städte, Institutionen, Szenen und Gruppen standen in steter Kommunikation miteinander und im Vergleich zueinander: Frankfurt, Köln, London, New York, Berlin, ... Was Daphne von Athen erzählte, ist ein typisches Beispiel. Es war nicht die entscheidende Frage, ob diese Netzwerke internetbasiert waren oder nicht. Wie können wir also die Zurückhaltung verstehen, aus dieser Perspektive Geschichtsschreibung zu praktizieren?
Vielleicht hat das auch etwas mit der narrativ-kritischen Strömung zu tun, die den neuen Medien und der Netzwerktheorie innewohnt, wo lineare Repräsentation kein wichtiges Thema ist. Deren Hauptagenda war üblicherweise, wie du in einem gegebenen Projekt auftratst oder arbeitetest und nicht, wie du davon erzähltest. Der Widerwille, diese Geschichte zu schreiben, entspringt also auch einer Art Repräsentationskritik, die dem Arbeiten in und mit Netzwerken innewohnt, sowie dem Wunsch nach Formen, die der Form selbst immanent sind
Aber was denkt ihr, warum wir diese Geschichte überhaupt aufschreiben müssen? Sobald du ein Buch schreibst, hältst du fest, verallgemeinerst du, schreibst du die Dominanz des Westens ein. Wer wären die Leute, die diese Geschichte schreiben und warum? Wer und was würde ausgelassen? Es gibt immer ein Problem zwischen den Topographien und den Topologien von Netzwerken. Die Orte, die auf der Karte als wichtig erachtet werden, bestimmen am Ende die starken Knoten des Netzwerks.
Ich denke, das hängt auch mit der Frage zusammen, was wir tatsächlich aus diesen Geschichten der ‚Kritischen Internetkulturen‘ lernen können und was diesbezüglich dann die unerkannten Auslassungen des gegenwärtigen Moments sind. Clemens hat beispielsweise ein Buch über „vergessene Zukünfte“1 mitherausgegeben. Darin wird vorgeschlagen, auch jene Netzkulturen in Betracht zu ziehen, die nie stattgefunden haben oder nie bekannt wurden. Das wirft eine weitere Frage bezüglich der Grenzen von Netzwerken auf.
- 1. Clemens Apprich und Felix Stalder (Hg.), Vergessene Zukunft. Radikale Netzkulturen in Europa, Bielefeld: transcript Verlag, 2012.
Ja, aber das Problem bleibt bestehen – auch in spekulativen Darstellungen der Geschichte von Netzwerken. Jede Geschichte verschiebt sich je nach unserem Ort und Standpunkt. Es ist interessant, wie das Netz zum Beispiel in Lateinamerika diskutiert und theoretisiert wurde. ‚La red‘ statt des ‚Netzwerks‘ ruft ein ziemlich anderes Verständnis und Bild dessen hervor, was eine Verbindung ist. Tania Pérez-Bustos, eine Anthropologin aus Bogotá, beschreibt, wie dieser Begriff (der dem Englischen ‚the web‘ entspricht) mit Techniken des Webens, also einer performativen Handlung, verknüpft ist1. Ein solches Verständnis entfacht eine andere Geschichte des Netzwerks mit all seinen unerzählten und nicht verwirklichten Fäden, die wir hier zusammenzuweben versuchen. Ich denke, am Ende sind wir alle in unseren eigenen Geschichten des Netzes mit ihren Eigenheiten und Auslassungen gefangen.
- 1. Gespräch bei einem Workshop in Bogotá, Kolumbien im Februar 2015. Für einen Workshopbericht, siehe: Sara Morais dos Santos Bruss, ‘Making Change – A Report from Bogotá’, spheres – Journal for Digital Cultures 2 (2015), spheres Journal
Das hängt von der Sichtweise ab. Früher gab es viele Diskussionen über Netzwerke als ‚ummauerte Gärten‘. Da Netzwerke auf Gleichförmigkeit beruhen, könnte man sagen, dass das, was jenseits des eigenen Netzwerks liegt, Differenz ist. Andere Welten, andere Meinungen und Wirklichkeiten werden von dir ferngehalten. Netze sind nicht durchlässig. Sie sind verletzlich, wie Geert an anderer Stelle bespricht, aber sie sind nicht durchlässig; sie sind nicht einfach zu durchbrechen.
Das Gleiche gilt für den Begriff ‚Community‘. Er hat etwas ausschließendes, obwohl er eigentlich einschließend sein sollte. In seiner Theorie der städtischen Gemeingüter problematisiert der Aktivist Stavros Stavrides den oft privatisierten und geschlossenen Charakter von Communities1. Stattdessen befürwortet er gemeinsame Räume, die nicht von Grenzen bestimmt sind und für Neue offen bleiben. Solche Prozesse erfordern radikal neue gesellschaftliche Verhältnisse, die auf Gleichheit und Solidarität beruhen. Stavrides spricht vor allem über städtische Umgebungen und soziale Praktiken, die sich beide in den digitalen Raum ausdehnen – oder, andersherum, zunehmend von und in Interaktionen mit digitalen Infrastrukturen organisiert sind.
- 1. Siehe etwa Stavros Stavrides, Common Space. The City as Commons, Chicago, IL: University of Chicago Press, 2016; Stavros Stavrides, Common Spaces of Urban Emancipation, Manchester, UK: Manchester University Press, 2019.
Da wir über die Grenzen und das Jenseits von Netzwerken nachdenken, muss ich an das ‚System‘ denken. Es war in gewisser Hinsicht das erste Opfer des Netzes. Vor den 1990er Jahren war das System – nicht das Netz – das vorherrschende Konzept, um Gesellschaft zu beschreiben. Doch mit einer zunehmend globalisierten und vernetzten Welt zerbrach die Vorstellung von gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen und sogar vom Nationalstaat als geschlossenen Systemen. Das System bekam Lecks und öffnete sich in unzählige Netzwerke. Für manche hatte das eine befreiende Wirkung, aber es brachte auch Probleme mit sich. Jenseits eines Netzwerks gibt es immer ein weiteres Netzwerk. Wie Wendy Chun sagt: Das Netz ist ein solch allumfassendes Konzept, weil du damit – oder besser: darin – immer suchst, aber nie findest1. Du vergrößerst und verkleinerst das Bild, wechselst von einem Netz in ein anderes. Das Netz gibt dir die Möglichkeit – oder sogar die Entschuldigung – keine Entscheidung zu treffen, kein Innen und Außen zu definieren, nicht nach einem Ausgang zu suchen. Im Netz bist du gefangen.
Doch wie Deleuze und Guattari gezeigt haben, hat jede Wiederholung das Potenzial der Differenz – der Verzweigung. Besonders wiederholend erscheinen jene Dinge, die das größte Potenzial haben, etwas Neues zu erschaffen. Ich mag an dieser Idee, dass Verzweigungen die ganze Zeit geschehen. Darauf will ich in meinem Essay für diesen Band hinaus: dass das Netz noch immer dieses Potenzial hat; dass es verschiedene Zeiten und Orte verbinden kann. Ich möchte gegen einen netzförmigen Pessimismus argumentieren – also gegen die Vorstellung, dass alles in einem Netz gefangen und eingeschlossen ist. Man kann einfach nicht alles einfangen.
- 1. Wendy Chun, Updating to Remain the Same, Cambridge, MA: MIT Press, 2016, S. 29 ff.
Es ist ein wichtiges Argument, dass Differenz immer erzeugt werden kann, aber in dieser Deleuzianischen Perspektive kann politisch auch eine Falle stecken. Ich denke hier an die heute so spürbaren harten Kanten von Netzwerken entlang kapitalistischer, rassistischer, sexistischer und damit verwandter Diskriminierungen. Trotz der Nutzung von vernetzten, vermeintlich horizontalen sozialen Medien, sind Ausschlüsse ja bei Weitem nicht verschwunden. Alle sind auf der Plattform, aber es ist zu einem in Bevölkerungsgruppen aufgespaltenen Raum geworden. Ich denke, das ist eine Frage der Praxis und der Möglichkeit: Was steht bei der Netzwerkfrage am Ende auf dem Spiel?
Die Idee ist eben nicht, politische Kategorien wie Geschlecht, Klasse oder race in einem Netzwerkideal zu verstecken oder aufzulösen, sondern deren Grenzen sichtbar und damit greifbar zu machen, um Verzweigungen zu ermöglichen.
Ich denke noch immer in massenpsychologischem Sinne, dass das Netzwerk eine von vielen Möglichkeiten ist, das Soziale zu organisieren. So wie es auch Zellen, Gruppen, Gesellschaften, Communitys, Gemeinden, Verbände und politische Parteien gibt. Vielleicht verändert sich und wächst diese Liste in den kommenden Jahrzehnten. Vielleicht kehren manche Formen der gesellschaftlichen Organisierung zurück. Sollten wir uns neue Formen des Sozialen ausmalen und gestalten, die es noch nicht gab, anstatt uns auf die alten Formen zu beziehen, mit denen wir vertraut sind?
Es ist auch wichtig zu beachten, wie in der jeweiligen Epoche das vorherrschende Modell eines Netzwerks aussieht. Heute hat sich die Diskussion in den Bereich der künstlichen Intelligenz verschoben, wobei das dominante Modell das künstliche neuronale Netz ist. Das bringt uns zu den Topologien, die im Vergleich zu den bisher angetroffenen informationellen und sozialen Netzen viel komplizierter sind, viel undurchsichtiger, auch wenn sie sich alle irgendwie überschneiden. Ich habe das Gefühl, dass dies auf den Diskurs über Netze wirkt, zum Beispiel, wenn wir über das intelligent vernetzte Haus, Smart Home, oder die Intelligente Stadt sprechen. Denn diese Umgebungen, in denen wir leben, werden auf Grundlage der Funktionsweisen dieser Maschinen angepasst; daran, wie diese Maschinen sehen, lesen und die Welt wahrnehmen.
Das Feld der Netzwerkanalyse, das die treibende Kraft hinter den meisten heutigen Anwendungen von KI und maschinellem Lernen ist, bestimmt tatsächlich schon vor, wie wir die Welt sehen, wie Dinge für uns gefiltert werden, und auch, wie die Welt uns sieht. Denken wir an Empfehlungssysteme. Sie folgen einer sehr groben Netzwerklogik, die dir sagt, dass du mögen solltest, was andere mögen, die dir ähnlich sind – oder, dass die Bekanntschaft von deiner Bekanntschaft auch deine Bekanntschaft sein sollte. Das führt zu den viel diskutierten Filterblasen und Echokammern. Doch das muss nicht so sein, das ist ja kein Naturgesetz. Wir könnten uns andere Netzwerklogiken ausdenken. Das Problem mit der dominanten Logik ist, dass sie unsichtbar geworden ist und daher wirkt, als sei sie tatsächlich natürlich.
Die Unsichtbarkeit des Netzes hat uns also in gewisser Hinsicht aufhören lassen, uns darauf zu beziehen. Das ist ein bisschen wie das, was Wendy Chun in ihrem Buch Updating to Remain the Same: Habitual New Media (dt. etwa: Aktualisieren, um Dasselbe zu bleiben – Gewohnheitsmäßige Neue Medien) bespricht. Je weniger wir Netzwerke oder Technologien sehen oder beachten, desto weniger benennen wir sie und denken über sie nach. Das bedeutet aber nicht, dass Netzwerke keine bedeutende Rolle spielen. Eigentlich spielen sie eine noch wichtigere Rolle, da wir selbst zu den Maschinen und Netzen werden. Sie bestimmen unser tägliches Leben und unsere Gewohnheiten.
Genau. Das Netz ist so durchdringend geworden, dass alle seiner Logik folgen. Aber wie viele Menschen kennen eigentlich TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), zum Beispiel, oder andere Internetprotokolle? Ich würde sagen, dass sogar die Mehrheit der Medienwissenschaftler*innen nicht wissen, wie das Internet eigentlich funktioniert, geschweige denn, wie es entstanden ist. Bloß weil es funktioniert, sollten wir nicht aufhören, kritisch darüber nachzudenken. Ein mediengenealogisches Verständnis wäre hier von Vorteil.
In den späten 1990er Jahren wurde die Netzwerktheorie zur Netzwerkforschung und fand dann ihr Ende. Ich sage nicht, dass dann die Leute aufgehört haben, über Netze nachzudenken, aber diese bestimmte Strömung kam zum Stillstand. Castells’ Netzwerkgesellschaft ist nicht breit aufgegriffen worden. Ich war kürzlich in Kontakt mit ein paar Leuten in der Europäischen Kommission in Brüssel, die starke Befürworter*innen der Netzwerkforschung sind. Ich forderte sie heraus, zu belegen, dass diese Forschung heute lebendig und relevant ist. Was wurde zuletzt von ihr hervorgebracht? Es gibt einen Wunsch, Wissenschaftler*innen heranzuziehen. Die ganze Welt der sozialen Netzwerke ist für sie so düster, substanzlos und vertrackt geworden, dass sie den Eindruck hatten, Wissenschaftler*innen wieder mit an Bord holen zu müssen, um all die Mythen ein für allemal loszuwerden – die kommerziellen Interessen und die versteckten Kräfte. Aus dieser Sicht ist das Netz eine mysteriöse unsichtbare Macht, die Fake News hervorbringt und daraus Verschwörungen spinnt.
In den Sozialwissenschaften sagen immer mehr Leute, dass wir technische Lösungen einführen müssen, weil für sie unser Verständnis von Gesellschaft völlig gescheitert ist. Aber wir sind schon auf komplexe Weise in einer technischen, bürokratischen Gesellschaft verfangen: Das ist unsere Wirklichkeit. Also ist diese Begrenzung des Horizonts ziemlich real. Sie eröffnet überhaupt keine Diskussion über Alternativen. Ich wünschte, es gäbe eine andere Art von Netzwerktheorie, die jetzt gedeihen könnte. Dann wäre die Diskussion an diesem Tisch eine ganz andere. Was wäre geschehen, wenn dezentralisierte Netze programmiert worden wären, um sich jeglicher Form der Zentralisierung zu widersetzen?
Das hängt damit zusammen, was ich über die Grenzen von Netzen gefragt habe. Du beschreibst eine Grenze, bezüglich nur einer bestimmten Art des Umgangs oder des Denkens über Netze. Könnten wir nicht sagen, dass die Grenzen der Netzwerkforschung eigentlich – wie bei vielen anderen Netzmodellen – mit diesem typischen Bild von Netzwerkkanten und -knoten verknüpft ist? Aus diesem Bild setzt sich eine flache Ontologie zusammen, in der einerseits alles möglich ist, aber andererseits alles nachverfolgt und kartiert wird. Wenn wir über Unsichtbarkeit sprechen, scheint es, als ob wir nicht über die übliche Frage des Maßstabs sprechen, sondern über eine Art multiversalen Denkens, dem eigentlich oft ein Netzwerkdenken fehlt. Das gilt besonders, wenn wir uns ins Zeitalter der auf tiefem Lernen und neuronalen Netzen beruhenden KI bewegen. Fake News, Propaganda und so weiter – sie zeigen in ihrer Banalität auf viele versteckte Netzwerke, die zur gleichen Zeit operieren und so den allgemeinen Netzwerkeffekt erzeugen. Es ist dieser multiversale Betrieb, der die neue Netzwerkforschung enorm erfolgreich macht, etwa in der Manipulation des Wahlvorgangs in den USA.
Eine interessante und gewissermaßen eingebaute ‚Grenze‘ des Netzes im Zusammenhang mit KI und maschinellem Lernen liegt in den ersten Anfängen der Kybernetik. Wie Orit Halpern ausgeführt hat, führte die kybernetische Vision von Warren McCulloch und Walter Pitts, die 1943 die Möglichkeit eines künstlichen neuronalen Netzes theoretisierten, die beiden zu einer rechnerischen Rationalität, die nicht länger auf Vernunft beruhte1. Daraus folgt ihres Erachtens, dass das Netz psychotisch wird; es führt zu einer Überproduktion von Bedeutung, einer vernunftlosen Situation, in der jede Form der symbolischen Schließung nicht länger relevant ist. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden: Künstliche neuronale Netze fördern einen übermäßig induktiven Ansatz und verwerfen zugleich die Idee des symbolischen Denkens. Schau nur die Daten an und der Rest ergibt sich von selbst. Doch sind es immer noch Menschen, die diese Modelle bauen; und sie implementieren unvermeidlich ihr sehr spezifisches und voreingenommenes Verständnis dessen, was sie mit den Daten vorhaben. Dieses symbolische Gepäck lässt sich nicht einfach in eine vermeintlich flache Ontologie auflösen oder in einem netzwerkwissenschaftlichen Diskurs verbergen. Wie die Psychoanalyse wieder und wieder gezeigt hat: Immer, wenn wir das Symbolische zu verdrängen versuchen, taucht es an anderer Stelle wieder auf. Es ist also keine Überraschung, wenn künstliche neuronale Netze entlang der Achsen von gesellschaftlichen – das heißt, symbolischen – Ungleichheitsstrukturen diskriminieren. Sie sind also am Ende gar nicht unlogisch, sondern folgen den Voreingenommenheiten, die wir als Gesellschaft produzieren.
- 1. Orit Halpern, Beautiful Data: A History of Vision and Reason since 1945, Durham, NC: Duke University Press, 2015.
Diese Art von wissenschaftlichem Ansatz dominiert, obwohl er selbst unsichtbar ist. Über diesen Ansatz wird nicht gesprochen, er wird bloß in alle möglichen Software- und Programmierschnittstellen übersetzt. Und dann sind Millionen oder Milliarden von Menschen mit ihnen konfrontiert. Aber die Sache selbst liegt außerhalb des Rahmens und vielleicht ist es nötig, alle daran zu erinnern, dass der Ansatz einer strengen Netzwerkforschung überaus erfolgreich ist. Er hat sich konzeptuell nicht vorwärtsbewegt und hat kategorisch ausgeschlossen, sich mit benachbarten Ansätzen auseinanderzusetzen. Zumal er mit aller Kraft implementiert wird. Deswegen sind viele Leute womöglich zögerlich, das Netz für tot zu erklären, weil es das offenbar nicht ist.
Ja, genau das ist der Punkt. Ich würde nur in einer Hinsicht widersprechen: Ich denke nicht, dass diese Netzwerkmodelle außer Reichweite sind; ihr Aufbau und ihre Funktionsweise sind nicht verborgen und unbekannt [black-boxed], wie oft suggeriert wird. Wer mehr über neuronale Netze oder maschinelles Lernen erfahren möchte, kann zum Beispiel die TensorFlow-Plattform von Google herunterladen und nutzen. Klar lässt sich hier entgegnen, dass diese an sich schon einen technischen Rahmen darstellt, der für die meisten Menschen noch immer außer Reichweite ist. Aber für Leute in der Medienforschung, der Kunst oder im Aktivismus, die sich mit diesen Debatten auseinandersetzen möchten, sehe ich keinen Grund, warum sie einen von Google angebotenen Crashkurs in maschinellem Lernen nicht wahrnehmen sollten.
Wir können die Diskussion über das Black-Boxing von Technologien ewig fortsetzen. Meines Erachtens ist das eine Frage mit vielen Facetten. Das hängt davon ab, worüber wir genau sprechen. Wenn du ein Produkt kaufst, das auf KI basiert, werden sie dir nicht verraten, wie genau es auf der Grundlage von Stimmerkennung funktioniert und wie es von Werber*innen benutzt wird. Der Begriff black-boxing ist noch immer verbreitet, weil Nutzer*innen erneut nicht wissen, was mit ihren Daten geschieht. So verstehe ich das zumindest im Fall von Sprachdiensten wie Amazons Alexa. Ich habe jüngst gelesen, dass Alexa Aufgaben der Gesundheitsversorgung übernehmen soll. Werden die Nutzer*innen darüber informiert, wie und von wem ihre gesundheitsbezogenen Daten genutzt werden?
Ich denke, Alexa, Siri, oder Googles Persönlicher Assistent sind gute Beispiele, um das Konzept der Black Box zu erweitern. Schließlich bedeutete deren Konzeptualisierung in der Kybernetik nicht, dass wir sie nicht anfassen sollten. Im Gegenteil: Die Black Box wurde als ein methodologisches Werkzeug eingeführt, um mit komplexen Systemen zu experimentieren. Warum also nicht mit Alexa, Siri und Co. experimentieren? Das kann auf technischer Ebene ebenso geschehen wie auf einer künstlerischen, theoretischen oder sogar rechtlichen Ebene. Wenn wir eine Kritik dieser Systeme formulieren wollen, sollten wir uns die Hände schmutzig machen.
Vielleicht müssen wir die Rolle von algorithmischer Entscheidungsfindung und -automatisierung im Verhältnis zur menschlichen Entscheidungsfindung in Betracht ziehen. Wenn es um soziale Netzwerke oder kulturelle Netzwerke geht, oder darum, wie wir zusammenarbeiten, liegt es grundlegend an uns, in welchem Maße wir Netzwerke aufbauen können, in denen wir die Bedeutung von Differenz anerkennen und der Schaffung geschlossener Welten entkommen.
Geert, du zitierst in deinem Text den Vorschlag von Tiziana Terranova, die Vorstellung des Konnektionismus von unserem gegenwärtigen Modell hin zu einem der Quantenverschränkung zu verschieben. Das ist ein sehr spekulativer Ansatz – sie sagt, dass das auch „unheimliche“ Ergebnisse haben könnte.
Hier wird deutlich, dass Netzwerke auf verblüffenden Erfahrungen beruhen. Sie werden durch die endlose Produktion von Selbigkeit zentralisiert. Manche Dating-Apps spielen damit. Die meisten produzieren eine langweilige Wiederholung von solcher Gleichförmigkeit: Du versorgst die App mit deinen Angaben und sie sucht dann nach Übereinstimmungen. Aber es gibt andere Logiken. Zum Beispiel konnten sich Menschen ganz am Anfang, während der kurzen Zeit der lokalisierenden Plattformen, auf der bloßen Grundlage ihres Ortes treffen. Und deshalb war das Matching viel willkürlicher. Daran dachte ich, als Terranova von „unheimlichen“ Ergebnissen sprach. Die ewige Rückkehr desselben kann aufgebrochen werden.
Übersetzung aus dem Englischen von Jen Theodor.